Was Bedeutungen sind II: die
kognitivistische Antwort
- Was an der Bedeutungstheorie
wirklich wundernimmt, ist, wie lange sie unter dem Joch philosophischer
Irrlehren gestanden hat und wie hartnäckig diese Irrlehren sind.
HILLARY PUTNAM
| Zwei Eigenschaften von Bedeutungeni | |
| I | Bedeutungeni sind im Kopf. D.h., wenn man eine bestimmte Bedeutung (Sinn, Intension) erfaßt, also einen gewissen Ausdruck versteht, dann befindet man sich in einem bestimmten psychischen Zustand. |
| II | Die Bedeutung (=Sinn, Intension) eines Ausdrucks bestimmt dessen Extension (Begriffsumfang) |
Hilary Putnam hat nun durch einige überzeugende Beispiele gezeigt, daß diese beiden Hypothesen nicht plausibel miteinander verträglich sind. Bedeutungen sind also entweder nicht (vollständig) im Kopf oder sie bestimmen nicht (vollständig) die Extension von Ausdrücken .
 Hilary
Putnam ist Professor für Moderne Mathematik und mathematische Logik
an der Harvard Universität. Wesentlich beeinflußt von Willard
van Ornim Quine, sieht sich Putnam selbst als einen der „Überwinder"
des Positivismus. Putnam ist Autor zahlreicher einflußreicher Aufsätze
und Bücher. „The meaning of ‚meaning'", „Realism with a Human Face"
und „Words and Life" sind prominente Beispiele.
Hilary
Putnam ist Professor für Moderne Mathematik und mathematische Logik
an der Harvard Universität. Wesentlich beeinflußt von Willard
van Ornim Quine, sieht sich Putnam selbst als einen der „Überwinder"
des Positivismus. Putnam ist Autor zahlreicher einflußreicher Aufsätze
und Bücher. „The meaning of ‚meaning'", „Realism with a Human Face"
und „Words and Life" sind prominente Beispiele.
"In this
bold, energetic, and extensive work, Putnam undertakes a revitalization
of philosophy. He wants to put philosophy back in touch with the 'human
issues which it has always been philosophy's highest goal to articulate'
. . . This is exciting and engaging stuff, and anyone with an interest
in philosophy, at whatever level, will enjoy it and learn from it.
(A. W. Moore, Times Literary Supplement)
Putnams Zwillingserde-Argument
„Irgendwo in derMilchstraße
gibt es einen Planeten den wir die Zwerde nennen. Die Zwerde ist gleichsam
ein Zwilling der Erde; die Menschen auf der Zwerde sprechen wahrhaftig
sogar Deutsch. Der Leser darf getrost annehmen, daß die Zwerde, abgesehen
von den Unterschieden, die wir in unserem Science-fiction-Beispielen angeben,
der Erde exakt gleicht. ...
Eine der zwirdischen Eigentümlichkeiten besteht darin, daß die Flüssigkeit, die dort ‚Wasser' genannt wird, nicht H2O ist, sondern eine andere Flüssigkeit mit einer sehr langen und komplizierten chemischen Formel, die ich hier einfach mit XYZ abkürzen will. Ich werde annehmen, daß sich XYZ bei normalen Temperatur-und Druckverhältnissen von Wasser nicht unterscheiden läßt. Insbesondere schmeckt es und löscht den Durst wie Wasser. Auch sei angenommen, daß die die Meere, Seen und Flüsse der Zwerde XYZ enthalten und nicht Wasser,, daß es auf der Zwerde XYZ regnet und nicht Wasser; und so weiter.
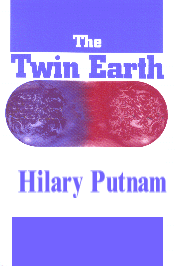 Wenn
ein Raumschiff von der Erde je die Zwerde besuchen sollte, so wird die
erste Vermutung sein, daß „Wasser" auf der Zwerde dieselbe Bedeutung
hat wie auf der Erde. Mit der Entdeckung, daß auf der Zwerde ‚Wasser'
XYZ ist, wird dieser Vermutung korrigiert werden, und das irdische Raumschiff
wird nach Hause funken:
Wenn
ein Raumschiff von der Erde je die Zwerde besuchen sollte, so wird die
erste Vermutung sein, daß „Wasser" auf der Zwerde dieselbe Bedeutung
hat wie auf der Erde. Mit der Entdeckung, daß auf der Zwerde ‚Wasser'
XYZ ist, wird dieser Vermutung korrigiert werden, und das irdische Raumschiff
wird nach Hause funken:
- „Auf der Zwerde bedeutet das
Wort ‚Wasser' XYZ."
- „Auf der Erde bedeutet das Wort
‚Wasser' H2O."
Drehen wir nun die Zeit ungefähr ins Jahr 1750 zurück. Sowohl auf der Erde wie auf der Zwerde war die Chemie damals noch nicht entwickelt. Ein des Deutschen mächtiger Erdling wußte damals normalerweise nicht, daß Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, und ein des Deutschen mächtiger Zwerdling wußte damals normalerweise nicht, daß ‚Wasser' aus XYZ besteht. Sei Oskar1 ein solcher Erdling und Oskar2 sein zwirdisches Gegenstück, und sei ferner angenommen, daß Oskar1 bezüglich Wasser dieselben Überzeugungen hat wie Oskar2 bezüglich ‚Wasser'. Wer will, kann ruhig annehmen, daß Oskar1 und Oskar2 in ihrem Aussehen, in ihren Gedanken und Gefühlen, in ihren inneren Monologen etc. sogar exakt übereinstimmen. Doch war die Extension des Ausdrucks „Wasser" auf der Erde im Jahre 1750 die gleiche wie im Jahre 1970, nämlich H2O; und die Extension des Ausdrucks „Wasser" war uaf der Zwerde im Jahre 1750 die gleiche wie im Jahre 1970, nämlich XYZ. Oskar1 und Oskar2 faßten also im Jahre 1750 den Ausdruck „Wasser" verschieden auf, obwohl sie sich im selben psychischen Zustand befanden und obwohl ihre Wissenschaften bei ihrem damaligen Stand noch etwa 50 Jahre brauchten, um zu entdecken, daß sie den Ausdruck „Wasser" unterschiedlich verstanden haben. Das heißt, daß die Extension des Ausdrucks „Wasser" keine Funktion allein des psychischen Zustands des Sprechers ist." (Putnam 1990. S. 32ff)
Schematische Zusammenfassung der Beobachtungen
| Sprecher und
Sprechzeitpunkt |
Extension | Für wahr gehaltene Äußerungen | |
|
W |
Erdling 1970 | H2O | Auf der Zwerde gibt es kein Wasser. Wasser ist H2O. |
| A
S |
Zwerdling 1970 | XYZ | Auf der Erde gibt es kein Wasser. Wasser ist XYZ |
| S
E |
Erdling 1750 | H2O | Auf der Zwerde gibt es Wasser |
| R | Zwerdling 1750 | XYZ | Auf der Erde gibt es Wasser |
Putnams Ulmen-Argument
Nehmen wir an, du ähnelst
mir darin, daß du gleich mir Ulmen und Buchen nicht auseinanderhalten
kannst. Wir sagen dennoch, daß die Extension von „Ulme" in meinem
Idiolekt dieselbe ist wie die Extension von „Ulme" im Dialekt anderer,
nämlich die Menge aller Ulmen, und daß die Extension von „Buche"
in deinem wie in meinem Idiolekt die Menge aller Buchen ist. „Ulme" in
meinem Idiolekt hat also (wie es sich gehört) eine andere Extension
als „Buche" in deinem Idiolekt. Ist es wirklich plausibel, daß dieser
Extensionsunterschied von einem Unterschied in unseren Begriffen
herrührt? Mein Begriff von Ulmen ist derselbe wie mein Begriff
von Buchen (wie ich zu meiner Schande gestehen muß). Sollte jemand
unverzagt weiter dabei bleiben wollen, daß sich der Unterschied zwischen
der Extension von „Ulme" und der von „Buche" in meinem Idiolekt durch eine
Variation in meinem psychischen Zustand erklären lasse, so können
wir ihn jederzeit durch die Konstruktion eines neuerlichen Zwerde-Beispiels
widerlegen: Man denke sich einfach die Wörter „Ulme" und „Buche" auf
der Zwerde vertauscht; außerdem nehme man an, daß auf der Zwerde
ein exakter Doppelgänger von mir existiert. Es ist absurd anzunehmen,
sein
psychischer Zustand sei auch nur ein Jota anders als meiner; und doch meint
er Buchen, wenn er „Ulme" sagt, und ich meine Ulmen, wenn ich „Ulme" sage.
Man kann's drehen und wenden, wie man will, Bedeutungen sind einfach nicht
im Kopf." (Putnam 1990. S. 36f)
Putnams Lösung: Bedeutungen sind
nicht im Kopf, bestimmen aber die Extension
Für Putnam tragen zweierlei Faktoren
zur Bestimmung der Extension bei: die soziale Umgebung und die natürliche
Umgebung. Das Ulmen-Argument suggeriert den Beitrag der sozialen Umgebung.
Häufig ist es so, daß nur einige Benutzer eines Wortes, die
Sachkundigen, dazu imstande sind, zuverlässig festzustellen, auf welche
Gegenstände ein Wort zutrifft. Laien sind bei der Verwendung dieses
Wortes auf die Kooperation mit den Sachkundigen angewiesen. Gemäß
Putnams These von der sprachlichen Arbeitsteilung reicht es aus,
wenn die Sprachgemeinschaft als ganze den Bezug ihrer Wörter bestimmen
kann. Die prinzipielle Verfügbarkeit geeigneter Experten für
die Bestimmung der Extension einzelner Wörter ist also, damit in einer
Sprachec die Extensionen ihrer Wörter festgelegt sind.
Die sogenannte kausale Theorie der Referenz (Kripke 1972) faßt Putnam
als Spezialfall dieser sprachlichen Arbeitsteilung auf. Denn diese Theorie
läuft gerade darauf hinaus, daß die Referenz etwa eines Eigennamens
dadurch bestimmt ist, daß seine Benutzer mit anderen Personen in
Kooperation stehen oder gestanden haben, die in der Lage sind sind oder
waren, den Namensträger zu identifizieren.
Das Zwillingserde-Argument zeigt, daß über eine versteckte Indexikalität auch die natürliche Umgebung zur Festlegung des Bezugs von Wörtern wesentlich ist. Ähnlich wie die Herstellung eines Bezugs für offen indexikalische Ausdrücke wie „du" und „ich" wesentlich von der Äußerungssituation abhängt (Wer ist der Sprecher und wer ist der Angesprochene?), so verhält es sich auch bei Wörtern wie Wasser, Erde, Luft und Feuer. Ihre versteckte Indexikalität besteht darin, daß in irgendeiner Umgebung oder irgendeinen möglichen Welt etwas genau dann z.B. Wasser ist, wenn es dem Wasser hier in unserer Umgebung gleicht.
Nun gibt es offenbar zwei Möglichkeiten, den Zusammenhang zwischen Bedeutung, individueller Kompetenz und Extension darzustellen. Die erste, von Putnam favorisierte Möglichkeit, sieht Bedeutung als eine Größe, welche die Extension bestimmt. Dazu faßt er Bedeutung als eine Art Vektor auf, der neben einer Komponente der individuellen Kompetenz auch Komponenten enthält, welche die soziale und natürliche Umwelt beschreiben und damit die Extension festlegen. Die Bedeutung als Ganzes kann dann nicht durch einen bestimmten psychischen Zustand determiniert sein. Was Putnam im Sinne hat, ist somit ein realistischer Bedeutungsbegriff. Bedeutungen als Ganzes können nicht individuell erfaßt werden. Das schließt nicht aus, das einzelne Komponenten psychologisch realisierbar sind, und Putnam legt Wert darauf, daß dies so ist. So ist für ihn auch das Herausfinden des geeigneten Systems zur Repräsentation von Stereotype keine Aufgabe der philosophischen Diskussion, sondern eine Aufgabe der kognitiven Linguistik und Psycholinguistik. Die Bedeutung von „Wasser" in unserer Erdlingssprache enthält laut Putnam etwa folgende Einträge:
Bedeutungc von Wasser
| semantischer Marker
(das sind Merkmale hoher Zentralität) |
natürliche Art, Flüssigkeit |
| Stereotyp
(bestimmt durch Merkmale mittlerer Zentralität) |
farblos, durchsichtig, ohne Geschmack, durstlöschend etc. |
| Extension | situationsabhängig, auf Zwillingserde bestimmt durch chemisches Wesen: H2O (mit oder ohne Beimengungen) |
Alternative Lösung: Bedeutungen
sind im Kopf, bestimmen aber die Extension nicht
Die zweite Möglichkeit sieht Bedeutungen
nicht als eine Größe, welche die Extensionen determinieren Sie
legen höchstens so etwas wie einen vermeintlichen (oder intern projizierter)
Bezug fest. Das läßt alle Möglichkeiten zur Korrektur offen.
Dabei spielen sowohl soziologischen Faktoren eine entscheidende Rolle (-
in gewissen Fragen verlasse ich mich lieber auf „Experten" -) als auch
Faktoren der natürlichen Umwelt. Wenn ich auf eine fremden Planeten
komme, dann halte ich zunächst all das für Wasser, was laut meinen
Stereotypen als solches erscheint. Stellt sich heraus, das gewisse (von
mir oder anerkannten Experten akzeptierte) Wesensmerkmale nicht zutreffen,
dann korrigiere ich meine Meinung, daß es sich hier um Wasser handelt.
Anders in meiner gewohnten Umgebung. Wenn ich (oder von mir anerkannte
Experten) feststellen, das alles, was ich bisher für Wasser gehalten
habe, nicht dem Wesensmerkmal „besteht aus H2O-Molekülen"
entspricht, dann werde ich meine Meinung, daß es sich hiebei um Wasser
handelt, vermutlich nicht korrigieren, sondern ich korrigiere das frühere
Wesensmerkmal und sage: Es hat sich herausgestellt, daß Wasser in
Wirklichkeit nicht aus H2O-Molekülen besteht, sondern aus
XYZ-Molekülen.
Bedeutungi von Wasser
| semantischer Marker | natürliche Art, Flüssigkeit |
| Stereotyp | farblos, durchsichtig, ohne
Geschmack, durstlöschend etc.
bestimmte Wesensmerkmale (besonders bei Kindern nur unklare Vorstellung) |
In unser gewohnten Umgebung bestimmt also das Stereotyp den projizieren Bezug, und auf der Zwerde bestimmt das Wesensmerkmal den projizieren Bezug. Die Salienzen der im Stereotyp verankerten Merkmale ändern sich in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort. Und das ist es, was die versteckte Indexikalität im der jetzt angenommenen kognitivistischen Grundhaltung (Bedeutungeni sind im Kopf) ausmacht. Peter Gärdenfors (1993) hat übrigens gezeigt, wie auf dieser Grundlage, so etwas wie eine „gemeinsame Bedeutung", Bedeutungc zustande kommen kann.
Putnam selbst hat in späteren Werken seine nunmehr als „metaphysischen Realismus" gebrandmarkte Position zugunsten eines „internen Realismus" aufgegeben. Dabei wird die Schwierigkeit des Realisten aufs Korn genommen, daß es mehrerer ‚wahre' Theorien über die Welt geben kann und keine Entscheidung zwischen diesen möglich und nötig ist. Das einzige, was der Realist tun kann, um Referenz eindeutig festzulegen, ist eine Art ‚metaphysischen Klebstoff' zu postulieren, der Referenz auf magische Weise festlegt. Innerhalb einer Theorie ist jedoch eine realistische Position nach wie vor angemessen. Für viele orthodoxe Anhänger des Realismus ist Putnam dadurch zum „Antirealisten" geworden.
Kurze Bemerkung zur Davidsonischen Semantik
In der Vorlesung zum Wahrheitsbegriff, haben
wir kurz die Vorstellung von Davidson betrachtet, demzufolge das Schema
W von Tarski zur Definition der Bedeutung von Ausdrücken der Objektsprache
verwendet werden kann, wenn die Metasprache und das Prädikat ist
wahr als verstanden angenommen werden.
 (W)
„S" ist wahr genau dann, wenn S' (wobei S' ein Satz der Metasprache ist,
der zu dem Satz S der Objektsprache korrespondiert)
(W)
„S" ist wahr genau dann, wenn S' (wobei S' ein Satz der Metasprache ist,
der zu dem Satz S der Objektsprache korrespondiert)